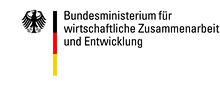In der idealen Entwicklungszusammenarbeit gehen diejenigen, die Hilfe benötigen, und diejenigen, die Hilfe geben können, Partnerschaften ein – sei es in Form finanzieller Unterstützung, technischer Hilfeleistungen oder der Beteiligung an Netzwerken. Ich habe das Glück, auf dem Gebiet der Entwicklungseffektivität zu arbeiten: Es geht vor allem darum zu überprüfen, ob die angestrebten Ergebnisse der Entwicklungskooperation in einem bestimmten Sektor oder zu einem bestimmten Thema erreicht wurden, und wenn nicht herauszufinden, was die Gründe für das Scheitern sind. Seit ich nicht nur in Kapstadt, sondern auch (dem DAAD sei Dank!) in Hamburg leben durfte, bewundere ich Städte, die ihren Einwohnern eine Work-Life-Balance ermöglichen (sollte ich etwa im Begriff sein, alt zu werden?!) und missbillige Städte, in denen Wachstum so gut wie unmöglich ist, weil jeder Verbesserungsversuch an einem der vielen Hindernissen scheitern muss, die ihm im Wege stehen.
Vielleicht hätte ich also in Genf bleiben sollen, meiner letzten „Pflichtstation“ als DAAD-Stipendiatin, oder nach Deutschland zurückkehren, wo Ausländer mit einem deutschen Universitätsabschluss ein 18-monatiges Visum für Arbeitssuche erhalten. Dort hätte ich in einer Stadt Arbeit finden können, die von schönster Natur umgeben ist, infrastrukturell keine Wünsche offen lässt und sich in sicherer Entfernung vom pazifischen Feuerring befindet, der für Länder wie die Philippinen ständige Erdbebengefahr mit sich bringt und ihnen über 20 Taifune im Jahr beschert.

Die Herausforderung für Megacitys wie Manila: eine funktionale und nachhaltige Infrastruktur © privat
Stattdessen bin ich nach meiner Abschlussarbeit über die Finanzierung urbaner Infrastruktur wieder in die Heimat zurückgekehrt. Hier arbeite ich in einem Team, das den Nutzen der Klimafinanzierung für die städtische Infrastruktur untersucht. An der Beschäftigung mit Stadtentwicklungsthemen gefällt mir, dass sie alle gleichermaßen betreffen – Reich und Arm, Gesunde und Kranke, die Gebildeten wie die Ungebildeten. Wir bleiben alle im Stau stecken, uns allen machen Überschwemmungen das Leben schwer, und manche von uns müssen sich sogar eine Zweitwohnung mieten, nur um zur Arbeit oder zur Schule zu kommen, weil es in Malina extrem zeit- und kräfteraubend ist, längere Strecken zurückzulegen. Auch andere Regionalzentren auf den Philippinen stehen mehr oder weniger vor diesen oder ganz ähnlichen Problemen. Die Geschäfte und Alltagsabläufe in Malina funktionieren gerade einmal sub-optimal, und rechnet man die Folgen des Klimawandels hinzu, so wird sich die Situation in zehn Jahren noch zugespitzt haben. Es stehen uns schwierige Zeiten bevor.
Hier bin ich also wieder, in meiner Heimat, in der ehrlichen Hoffnung, dass Länder wie die Philippinen auch in Zeiten ihres durchaus beeindruckenden Wirtschaftswachstums dafür Sorge tragen werden, Finanzmittel in den Aufbau einer klimaresistenten städtischen Infrastruktur zu investieren oder zumindest die institutionellen (und politischen) Barrieren allmählich zu beseitigen, die das verhindern. Denn für den Kampf gegen den Klimawandel stehen Fördermittel bereit, mit deren Hilfe man das Leben in den Megastädten nicht nur erträglicher, sondern auch nachhaltiger machen könnte. Das ist nur leider leichter gesagt als getan.

Neue Einblicke in Tokio: Beim Gipfeltreffen junger Führungskräfte repräsentierte ich die Asiatische Entwicklungsbank © privat
Vor kurzem war ich auf einem Gipfeltreffen junger Führungskräfte in Tokio, wo wir auch vom Außenminister, dem Bürgermeister von Tokio und anderen hohen Repräsentanten Japans empfangen wurden. Wir erhielten einen Einblick in den Übergang Japans von einer Politik der staatlichen Entwicklungshilfe zur Entwicklungskooperation. Abgesehen von der Bekräftigung der Bedeutung von Entwicklungspartnerschaften (vor allem im staatlichen und privatwirtschaftlichen Sektor) und einer Sicherung der Interessen der „unteren Hälfte“, betrifft das vor allem Maßnahmen, die über die traditionelle Infrastrukturbereitstellung hinausgehen, wie den Ausbau einer „Exporttechnologie“ (z. B. Frühwarnsysteme) und verstärkte Unterstützung für Maßnahmen zur Klimaresistenz in Entwicklungsländern.
Der Bürgermeister von Tokio erläuterte uns die Nachhaltigkeitskonzepte für seine Stadt (Autos mit Wasserstoffantrieb, die bei Stromausfall im Falle von Erdbeben einsatzbereit sind) und erklärte mit sichtbaren Stolz, dass es auf den Straßen dieser Megacity Tokio dank des hervorragenden öffentlichen Personennahverkehrs nicht einmal ein übermäßig starkes Verkehrsaufkommen gebe. Während meines Aufenthalts wurde ich selbst Zeugin zweier Erdbeben, aber schon nach kurzer Zeit ging alles wieder seinen gewohnten Gang (offenbar gehören sogar Erdbeben dort zur Routine). So eine katastrophenresistente Infrastruktur zu haben – davon können die Philippinen nur träumen.
Und während ich nun wieder zu Hause an diesem Blog schreibe, muss ich schmunzeln, weil es dank der Entwicklungszusammenarbeit möglich ist, Fragen der lokalen Entwicklung zu Angelegenheiten internationaler Beziehungen zu machen. Japan ist der höchste Beitragszahler zur Entwicklungshilfe für die Philippinen, und Deutschland hat weltweit eine Führungsrolle in Bezug auf die Klimaschutzinitiativen inne. Die Bereitstellung von städtischer Infrastruktur mag ein Problem sein, das sich auf lokaler Ebene lösen lässt. Aber für Themen wie Klimawandelresistenz gilt das nicht. Für erfahrene Praktiker ist das nichts Neues. Aber für Berufsanfänger wie mich, die gerade erst dabei sind, ihre ersten Beiträge zu diesem Feld zu leisten. Sicher, hier entgeht mir mancher Vorteil, den das Leben in einer europäischen Stadt (oder wie ich jetzt weiß, auch in Japan!) zu bieten hat. Aber es jetzt genau die richtige Zeit, auf den Philippinen zu sein und Worten Taten folgen zu lassen. Hoffentlich habe ich auch weiterhin Gelegenheit dazu!