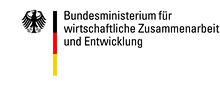Alumnus Johannes Horstmann über seine Erlebnisse in Haiti
Johannes Horstmann ist Absolvent des Studiengangs „Spatial Planning for Regions in Growing Economies“ (SPRING) an der Technischen Universität Dortmund. Von 2008 bis 2010 hat er in Haiti in Kooperation mit dem Deutschen Entwicklungsdienst (DED) in der Umweltabteilung des Entwicklungs-Programms der Vereinten Nationen (UNDP) gearbeitet. Auf der Dortmunder Konferenz zum Katastrophenmanagement und im Interview erklärt er, warum gute Planung über Menschenleben entscheiden kann.
Sie waren während des großen Erdbebens im Januar 2010 in Haiti. Wie haben Sie die Katastrophe erlebt?
Johannes Horstmann: Das Ausmaß der Katastrophe war unvorstellbar, schockierend brutal die Eindrücke – bis zu 75 Prozent von Port-au-Prince und der vom Erdbeben betroffenen Orte lagen in Trümmern. Während entlang vieler Straßen die Leichen abgelegt wurden, musste sich die Hilfe erst von Null auf neu organisieren. Die erste Woche nach dem Beben verbrachte ich mit anderen Ausländern in der UN-Basis am Flughafen. Dort wurden wir mit Rationspaketen der Blauhelm-Soldaten versorgt, weil Wasser und Nahrung knapp wurden. Parallel versuchten wir in der teilweise apokalyptisch zerstörten Stadt vermisste haitianische Kollegen zu finden und ihnen zu helfen.
In Entwicklungsländern kommt es häufiger zu Katastrophen als beispielsweise in Europa. Sind diese Regionen wegen des extremen Klimas besonders verwundbar?
Extreme Klimaereignisse und Naturgewalten gibt es überall. Eine Katastrophe entsteht, wenn die Menschen und Institutionen darauf nicht vorbereitet sind. In Kuba etwa treten genauso viele Hurrikans auf wie in Haiti. Trotzdem ist die Zahl der Opfer dort wesentlich niedriger, weil Organisationsstrukturen, Kommunikation und Zivilschutz besser funktionieren. Die Erdbeben-Katastrophen in Chile 2010 und in Japan zeigen, dass man sich auch hier besser anpassen und viele Opfer vermeiden kann.
Wie ist denn die Gesellschaft in Haiti auf Extremsituationen vorbereitet?
Generell funktioniert das Gemeinwesen in Haiti nicht gut. Wenn beispielsweise bei einem Verkehrsunfall Menschen verletzt werden, ist oft kein Rettungswagen in akzeptabler Reichweite. Man muss Anwohner oder vorbeikommende Autofahrer dazu bewegen, die Verletzten ins nächste Krankenhaus zu bringen. Ein anderes Beispiel ist die Brandbekämpfung: Nur wenige Städte haben überhaupt Löschfahrzeuge, es gibt praktisch keine systematisch organisierte Feuerwehr. Deshalb brennen immer wieder ganze Straßenzüge aus Holz ab. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre kommt hinzu, dass die Bevölkerung oft panisch reagiert oder Gerüchten Glauben schenkt, Warnungen nicht rechtzeitig bekommt oder ignoriert. Oft fehlen verlässliche, präzise Informationen.
Was könnte man mit besserer Planung erreichen?
Das Problem in Haiti ist nicht die mangelnde Planung, sondern die uneffektive Umsetzung. So gibt es zum Beispiel Bauvorschriften, aber keine Kapazitäten, um deren Einhaltung zu kontrollieren. Kaum eine Stadt hat aktualisierte Bebauungspläne. So lassen sich Menschen an steilen Hängen oder in den Flussbetten nieder, die den überwiegenden Teil des Jahres trocken sind. Doch bei Unwetter kommt es zu Erdrutschen am Hang, Häuser im Tal werden weggespült. Solche Überschwemmungen sind hausgemacht, weil die Wälder auf den Bergen gerodet wurden. Früher hat der bewaldete Boden wie ein Schwamm das Wasser aufgesaugt und es langsam an die Flüsse abgegeben. An kahlen Hängen aber schießt es ungebremst ins Tal und bekommt zerstörerische Kräfte. Dagegen helfen Terrassen-Feldbau und Wiederaufforstung. Insgesamt lassen sich lebensgefährliche Katastrophen durch effektive Landnutzungs- und Städteplanung vermeiden.
Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass sich nach der Katastrophe etwas ändert?
Viele sprachen von einer großen Chance für das Land, nämlich mit dem Wiederaufbau das Chaos hinter sich zu lassen. 15 Monate nach der Katastrophe leben immer noch 800.000 Menschen in Zeltlagern, da ist es zynisch und makaber, von einer großen Chance zu sprechen. Immerhin, der Bau von Notunterkünften geht langsam voran. Und Regierung und Hilfsorganisationen haben erkannt, dass sowohl Ingenieure als auch Maurer lernen müssen, ein Haus erdbebensicher zu bauen. Darüber hat vorher niemand nachgedacht. Man darf allerdings nicht vergessen: Für viele Familien ist weiterhin der Ingenieur und der geschulte Maurer beim Hausbau schon zu teuer. Sie können robuste Eisenverstärkungen oder Bauholz kaum bezahlen. So werden aus Armut mitunter die gleichen Baufehler wie vor dem Beben begangen. Derartige Teufelskreise gilt es zu durchbrechen.
Einige Eindrücke aus Haiti


 Mehr Fotos in unserer Galerie auf facebook
Mehr Fotos in unserer Galerie auf facebook